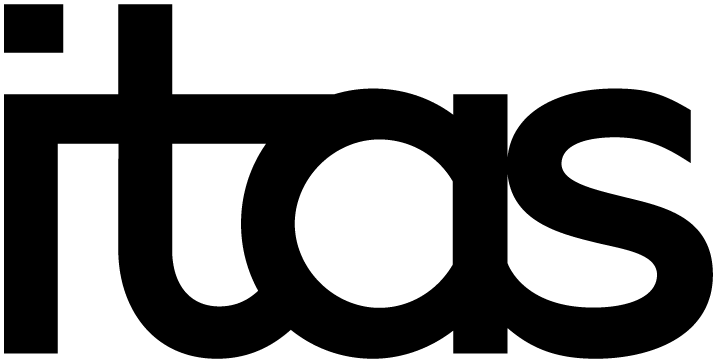Bürger:innendialog "Turbulenzen global, mitgestalten lokal" | KIT Science Week 2025
-
Veranstaltungsart:
Dialogveranstaltung
-
Datum:
18.10.2025
(Begleitevents am 01.10, 04.10. & 06.10.) -
Zeit:
14:00 - 18:00
-
Ort:
TRIANGEL Transfer | Kultur | Raum, Kaiserstraße 93, 76133 Karlsruhe
Turbulenzen global, mitgestalten lokal! Bürgerinnen und Bürger diskutieren Karlsruhes Zukunft im Dialog

Ein Blick in die Nachrichten genügt: Die Welt befindet sich im Wandel. Die globale Erwärmung oder die Zerstörung von Ökosystemen gefährden nicht nur unsere natürliche Lebensgrundlage, sondern bedrohen den Wohlstand auf der Erde. Gleichzeitig erleben wir, dass neue Technologien wie Künstliche Intelligenz zunehmend unseren Alltag prägen. Diese Veränderungen wirken auch auf unser Zusammenleben in und um Karlsruhe – heute und in Zukunft. Gleichfalls beeinflusst die Art und Weise wie wir uns fortbewegen, Grünflächen pflegen oder uns ernähren Gegenwart und Zukunft unseres Planeten.
Globale Krisen, lokale Lösungen: Im Rahmen der KIT Science Week 2025 kamen Bürgerinnen und Bürger, Forschende und städtische Vertreterinnen in den Räumlichkeiten der TRIANGEL zusammen, um über Karlsruhes Zukunft zu diskutieren. Unter dem Motto „Turbulenzen global, mitgestalten lokal!“ stand die Frage im Mittelpunkt, wie die Stadt in Zeiten von Klimawandel, Digitalisierung und gesellschaftlichem Wandel lebenswert bleiben und welche Beiträge das KIT dazu leisten könnte.
Nicht nur ein Dialog, sondern gleich vier
Vergleicht man den Dialog mit vergangenen Veranstaltungen, so fallen gleich mehrere Neuerungen auf. Erstmals wurde der Hauptdialog durch drei thematische Veranstaltungen im Vorfeld ergänzt. Hierzu gehörten:
- 01. Oktober 2025 | Grüne Oasen gegen Hitzefallen – wie sieht Karlsruhes begrünte Zukunft aus?
- 04. Oktober 2025 | Tram, Fahrrad, Flugtaxi – wie wollen wir uns morgen in und um Karlsruhe bewegen?
- 06. Oktober 2025 | Was bedeutet gutes Essen für uns? Gemeinsam über den Wert von Ernährung nachdenken.
Die Veranstaltungen ermöglichten es, spezifische Bereiche und Fragen konzentriert in den Blick zu nehmen – etwa die Vorteile und Herausforderungen, die mit der Pflanzung von schattenspendenden Straßenbäumen einhergehen oder worauf bei der Gestaltung unseres zukünftigen Ernährungssystems neben Geschmack und Umweltwirkungen noch geachtet werden sollte. Die Bürgerinnen und Bürger stellten fest, dass es sich häufig lohne, über die Grenzen von Karlsruhe und Deutschland hinaus zu schauen, sei es beim Hitzeschutz oder beim Umgang mit dem Verkehrsaufkommen.
Anschließend analysierten Forschende des Instituts für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS) die Ergebnisse der begleitenden Events und wählten zentrale Erkenntnisse für den Hauptdialog am 18. Oktober aus.
Auch dieses Jahr konnten Interessierte als Bürgerbotschafterinnen und Bürgerbotschafter dabei sein und so eine Brücke zwischen Wissenschaft und Gesellschaft bilden. Bei den Botschafterinnen und Botschaftern handelte es sich um Teilnehmende, die eingeladen wurden, bereits im Vorfeld, tiefere Einblicke in die Science Week zu erhalten und ihre Eindrücke in die Dialogveranstaltung mitzunehmen. So besuchten sie neben dem Hauptdialog weitere Veranstaltungen der KIT Science Week wie beispielsweise unterschiedliche Vorträge, einen Science Slam zur Stadt der Zukunft oder verfolgten das Debattenformat „13 Fragen“. Des Weiteren erhielten sie die Gelegenheit, in kleiner Runde ausgewählte ITAS-Forschung rund um nachhaltige Quartiersentwicklung und die Zukunft der Arbeit kennenzulernen.
Stadt und Forschung gemeinsam
Eine weitere Besonderheit der diesjährigen Dialogreihe lag in der engen Verbindung zwischen dem Dialogteam des ITAS und der Stadt Karlsruhe. So unterstützten insbesondere das Wissenschaftsbüro der Wirtschaftsförderung, die Initiative karlsruhe.digital und das Liegenschaftsamt der Stadt Karlsruhe die Vorbereitungen und Durchführung der einzelnen Veranstaltungen als Ansprechpersonen und Ideengeber rund um die Smart City Karlsruhe. Über das Netzwerk der Initiative karlsruhe.digital wurde außerdem die Kommunikation unterstützt. Digitale Stadtmodelle und Datentools halfen, Diskussionen anschaulich und lokale Perspektiven sichtbar zu machen. Hierzu gehörten etwa eine 3D-Karte, welche die Hitzebelastung in Karlsruhe veranschaulicht oder Ausschnitte aus dem Mobilitätsportal Karlsruhe.
Die Zusammenarbeit verdeutlicht, wie Forschung und Stadtverwaltung gemeinsam an nachhaltigen Zukunftsbildern arbeiten können. Des Weiteren begleiteten Forschende des Projekts „PaFo“ die vier Veranstaltungen, um mehr zu den relevanten Rahmenbedingungen und Wirkungen der Dialoge zu erfahren.
Der Hauptdialog: Bürgerinnen und Bürger als Expertinnen und Experten
Am Samstag, den 18. Oktober 2025, war es dann soweit: Eine vielfältige Gruppe Teilnehmender aus unterschiedlichen Stadtteilen diskutierte gemeinsam, wie Karlsruhe auch in Zukunft lebenswert aussehen könnte und erarbeiteten Impulse sowie Fragen für das KIT. Dabei hatten die Teilnehmenden auch Gelegenheit, sich über die digitalen Angebote der Stadt Karlsruhe zu informieren und sich mit städtischen Vertreterinnen zur Vision einer „Smart City“ auszutauschen. Am Infotisch der KIT-Initiative „wir forschen digital“ konnten sich die Anwesenden zudem spielerisch mit dem Erkennen von Phishing-Nachrichten beschäftigen.
Begrüßt wurden die Teilnehmenden von der stellvertretenden Institutsleiterin des ITAS, Constanze Scherz, und von KIT-Vizepräsidentin für Digitalisierung und Nachhaltigkeit, Prof. Dr. Kora Kristof, die später auch die Ergebnisse für das KIT entgegennahm.
Bevor es in den tiefergehenden Austausch ging, bildeten die Bürgerinnen und Bürger eine sogenannte „lebendige Statistik“. Dabei waren die Anwesenden eingeladen, sich zu unterschiedlichen Fragen und Thesen im Raum zu positionieren, etwa zur Frage: „Wie blicken Sie auf die Zukunft der Stadt Karlsruhe?“. Die Bürgerinnen und Bürger positionierten sich entlang einer Linie von „sehr optimistisch“ bis „sehr pessimistisch“ und äußerten sich punktuell in Form kurzer Statements. Das Format sorgte für einen lebendigen Auftakt und zeigte, wie unterschiedlich Zukunft wahrgenommen wird.
Weiter ging es mit einer Einführung von ITAS-Wissenschaftler Marius Albiez, ehe die Anwesenden in zwei Runden an sechs Diskussionstischen folgende Fragen diskutierten:
- Wie kann die Stadt den Hitzeschutz in Karlsruhe verbessern? (Tisch 1 und 2)
- (Wie) könnte der Mobilitätsbedarf in Karlsruhe verringert werden? (Tisch 3 und 4)
- Wie könnte sich die Karlsruher Bevölkerung sicher und bezahlbar mit Lebensmitteln versorgen? (Tisch 5 und 6)
Jede Diskussionsrunde startete mit einem kurzen Input aus der Forschung, gefolgt von einem „stillen Tischgespräch“. Bei dem Format werden eigene Perspektiven zunächst einmal mit Stift und Papier festgehalten – und zwar ohne sich akustisch bemerkbar zu machen oder zu unterhalten. Die Bürgerinnen und Bürger füllten dabei an den jeweiligen Tischen gemeinsam ein großes Flipchart mit ihren Gedanken und kommentierten bei Bedarf ausgewählte Punkte schriftlich. Die Methode erlaubt es, unterschiedlichen Diskussionscharakteren gerecht zu werden.
Nachdem die bunten Flipcharts in den Blick genommen wurden, leiteten die Moderierenden aus der Forschung zum intensiven Austausch über. Die Bürgerinnen und Bürger fungierten dabei als Expertinnen und Experten für ihre eigenen Lebenszusammenhänge. Entsprechend vielfältig waren die Bereiche und Themen, die angesprochen wurden. So reichte etwa die Spanne an Tisch vier von der Rolle der Arbeitgebenden, über Mobilitätseinschränkungen bis hin zum „Mind Set“ von Reisenden. Auf diese Weise füllten sich die großformatigen Blätter und Stellwände rasch mit Ideen und persönlichen Perspektiven, die je nach Situation durchaus engagiert – aber stets respektvoll – diskutiert wurden. Die Vertreterinnen der Stadt brachten auf Wunsch ihre Perspektiven ein und trugen dazu bei, die unterschiedlichen Standpunkte in den städtischen Gesamtzusammenhang zu bringen. Zum Abschluss jeder Tischrunde einigten sich die Anwesenden auf Impulse beziehungsweise Forschungsfragen, mit denen sich das KIT zukünftig eingehender beschäftigen sollte.
KIT-Vizepräsidentin nimmt Ergebnisse entgegen
Die Ergebnisse wurden schließlich aus dem Kreis der Bürgerbotschafterinnen und -botschafter an Vizepräsidentin Kristof übergeben. Diese griff die jeweiligen Ideen auf, ordnete sie ein und zog erste Verbindungen zur Forschung am KIT. Die Ergebnisse zeigen eine beeindruckende thematische Breite – von technischen Innovationen bis zu gesellschaftlichen Fragen. So schlugen die Bürgerinnen und Bürger beispielsweise vor, neue Materialien zur Fassadenkühlung zu entwickeln oder bereits etablierte „Best Practice“-Ansätze zum Hitzeschutz intensiv unter die Lupe zu nehmen. Des Weiteren wurde tischübergreifend die Relevanz von Kommunikation und Transfer betont – sei es, um bereits existierende Ansätze bedarfsgerecht zu vermitteln oder um theoretisches Wissen in die städtische Verwaltungspraxis zu bringen. Auch bekannte Lösungsansätze wurden durchaus kritisch in den Blick genommen und weiter gedacht. So regten die Teilnehmenden an, das Konzept der „15-Minuten Stadt“ nicht nur im Kontext von Metropolen, sondern auch für kleinere Städte und Gemeinden zu beforschen. Weitere Vorschläge beinhalteten, ein Reallabor für Ernährungsfragen aufzusetzen, mit enger Anbindung an lokale Landwirte sowie vertikale Landwirtschaft (vertical farming) in der Stadt zu fördern und zu beforschen.
Die Dialogergebnisse sollen nun innerhalb des KIT mit passenden Instituten und Zentren geteilt werden. Ziel ist es, Anknüpfungspunkte für Forschung und Entwicklung zu identifizieren und, wo möglich, in laufende oder neue Projekte einzubringen. Die Veranstaltung dient zudem als Inspiration für die Weiterentwicklung der Dialogformate am ITAS.
Der Nachmittag zeigte, wie groß das Interesse der anwesenden Karlsruher Bevölkerung an gemeinsamer Zukunftsgestaltung und Forschung ist.
Kontakt
- Marius Albiez(marius.albiez1∂kit.edu)
- Andreea Koch(andreea.koch∂kit.edu)
Der Bürger:innendialog ist eine Veranstaltung im Programm der KIT Science Week 2025, gefördert vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) und dem Wissenschaftsministerium Baden-Württemberg im Rahmen der Exzellenzstrategie von Bund und Ländern.